Sinnvoller Umgang mit Süßungsmitteln
Tilman Flechsig • 16. August 2023
Tabelle Süßungsmittel
Mannit (E 421)
Isomalt (E 953)
Polyglycitolsirup (E 964)
Maltit (E 965)
Lactit (E 966)
Xylit (E 967), auch "Birkenzucker" genannt
Erythrit (E 968) Dieser Stoff wird weiter unten gesondert besprochen.
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird das Wort "Zucker" synonym für "Rübenzucker" bzw. "Haushaltszucker oder Industriezucker (= Saccharose )" verwandt. In "Zuckerraffinerien" wird dieser aus Zuckerrüben in Reinform gewonnen. Die so gewonnene Saccharose ist ein sogenannter Zweifachzucker aus den Einfachzuckern Glucose und Fructose.
In der Chemie ist der Begriff "Zucker" ein Oberbegriff für energiereiche Verbindungen aus der Synthese von Pflanzen. Auch die Einfachzucker Glucose
(Traubenzucker), Fructose
(Fruchtzucker) und Lactose
(Milchzucker) gehören zu den Zuckern. Für die Zahnheilkunde ist bedeutsam, dass die Kariesbakterien im Mund alle diese Einfach- und Zweifachzucker zu Säure verstoffwechseln, was nachfolgend eine Auflösung des Mineralmantels der Zähne, also Karies führen kann.
Zucker ist lecker. Zu viel Zucker kann aber auch Erkrankungen wie Übergewicht, Diabetes, Verschlusskrankheiten (Herzinfarkt, Thrombosen etc.) und natürlich auch Karies verursachen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt nicht mehr als 5% des täglichen Energiebedarfes
durch Zucker zu decken. Dieser Wert wird in Deutschland heutzutage allerdings um das Doppelte überschritten. Ein Grund hierfür sind hohe Zuckeranteile in verarbeiteten Lebensmitteln (Fertiggerichte, Konserven u. ä.), auch "versteckte Zucker" genannt. Deshalb werden schon seit Jahrzehnten Ersatzstoffe gesucht, die gesünder, kalorienärmer und zahnschonender sind. Allerdings sind die meisten dieser Süßungsmittel deutlich teurer als Haushaltszucker, der mit unter 3.-€ für ein Kilo unschlagbar günstig ist.
Die Zuckeralternativen
lassen sich in drei große Gruppen einteilen:
1) Zuckerhaltige Nahrungsmittel ohne die lebensmittelrechtliche Bezeichnung „Zucker“
Dabei handelt es sich in der Regel um wenig verarbeitete zuckerhaltige Lebensmittel, die wie der klassische Zucker zum Süßen eingesetzt werden können. Sie haben ähnlich viele Kalorien, verursachen die selben Krankheiten und führen ebenfalls zu Karies. Sie sind eventuell gesünder, weil sie noch wertvolle Begleitstoffe, Vitamine oder Mineralien im Vergleich zu reinem "Industriezucker" enthalten. Bekannte Beispiele sind:
Agavendicksaft (Fructose) , Kokosblütenzucker (Fructose) , Honig (Fructose/Saccharose. = „Invertzucker“) , Melasse (Saccharose.) , Birnendicksaft (Fructose) , Ahornsirup (Saccharose), Dattelsüße (Fructose)
Aus zahnärztlicher Sicht bieten diese Nahrungsmittel, die einfach nur aus naturbelassenen Einfach- oder Zweifach-Zuckern
bestehen, keine Vorteile
gegenüber gewöhnlichem Zucker, weil die Mundbakterien diese Kohlehydrate in gleicher Weise verstoffwechseln können und somit die gleiche Kariesgefahr besteht.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist auch, Fruchtzucker (Fructose) sei vitaminhaltig oder besonders gesund. Das ist nicht der Fall! Übrigens: Haushaltszucker besteht wie oben bereits erwähnt zu einem Teil aus Fruchtzucker ...
Honig
besteht aus zum größten Teil aus Fructose (Fruchtzucker), Glukose (Traubenzucker) und Wasser. Weitere Bestandteile sind Mineralien, Enzyme, Vitamine und Aminosäuren. Diese Bestandteile werden für positive gesundheitliche Wirkungen verantwortlich gemacht. Ernährungsphysiologisch dominiert aber der Hauptbestandteil: Zucker.
Aus zahnmedizinischer Sicht ist Honig genauso stark kariesfördernd wie Haushaltszucker. Er hat beim Süßen von Speisen allerdings einen Vorteil: Sein starker Eigengeschmack führt eher dazu, dass man weniger nimmt.
Ein Sonderfall ist Isomaltose (auch Isomaltulose, Handelsname Palatinose), ein Zweifachzucker, der wie Saccharose aus Glucose und Fructose besteht. Beide Einfachzucker sind chemisch anders aneinander gebunden, was zwei interessante Effekte hat: Isomaltose ist zum einen nicht kariogen, weil die Mundbakterien ihn nicht verstoffwechseln können, zum anderen wird dieser Zucker vom Körper langsamer aufgenommen als Haushaltszucker, weshalb er eine weniger starke Insulinausschüttung
auslöst. Hierdurch wird die berühmte Hungerattacke durch die massive Insulinauschüttung nach klassischem Zuckergenuss vermieden. Isomaltose eignet sich zum Kochen und Backen, hat insgesamt aber die gleiche Kalorienmenge wie Haushaltszucker. Preislich ist Isomaltose deutlich teurer als Haushaltszucker.
Unser Fazit: Sehr empfehlenswert!
Ein weiterer besonderer Zucker ist Yacon-Sirup, ein sog. Oligofructan. Es handelt sich um einen Mehrfachzucker aus Gruppe der Polyfructane, der ein natürlicher Pflanzenbestandteil (z. B.: Yacon-Planze) ist. Er ist aus einer Kette von
3-10 Fructoseeinheiten und einem endständigen Glucoserest aufgebaut. Es findet keine Resorption im Darm und keine enzymatische Spaltung durch Verdauungsenzyme statt. Somit hat dieser Zucker keinen Einfluss auf den Blutzucker. Er ist auch zahnfreundlich, weil ihn Mundbakterien nicht verstoffwechseln können. Da er im Dickdarm durch Bakterien abgebaut wird, kann er in größeren Mengen zu Blähungen führen. Yacon-Sirup schmeckt süßlich (30-50% der Süße von Haushaltszucker) und ist ein zugelassener Zuckeraustauschstoff.
Unser Fazit: Empfehlenswert, allerdings sehr teuer.
3-10 Fructoseeinheiten und einem endständigen Glucoserest aufgebaut. Es findet keine Resorption im Darm und keine enzymatische Spaltung durch Verdauungsenzyme statt. Somit hat dieser Zucker keinen Einfluss auf den Blutzucker. Er ist auch zahnfreundlich, weil ihn Mundbakterien nicht verstoffwechseln können. Da er im Dickdarm durch Bakterien abgebaut wird, kann er in größeren Mengen zu Blähungen führen. Yacon-Sirup schmeckt süßlich (30-50% der Süße von Haushaltszucker) und ist ein zugelassener Zuckeraustauschstoff.
Unser Fazit: Empfehlenswert, allerdings sehr teuer.
2) Zuckeraustauschstoffe => Alditole bzw. Zuckeralkohole
Diese Stoffe haben trotz ihres Namens nichts mit Spirituosen (Ethanol) zu tun, sondern sind Reduktionsprodukte von Zuckern, die süß schmecken, aber durch ihre chemische Struktur dem Körper weniger Energie liefern. Sie kommen natürlich in verschiedenen Pflanzen vor, werden aber inzwischen industriell hergestellt. Sie werden insulinunabhängig verstoffwechselt und sind deshalb für Diabetes gefährdete Menschen interessant. Zuckeraustauschstoffe schmecken sehr zuckerähnlich, liefern Masse, Konsistenz und weniger Kalorien als Haushaltszucker. In großen Mengen konsumiert wirken sie abführend, weil sie im Darm nur langsam aufgenommen werden und Wasser binden. Aus zahnmedizinischer Sicht ist bedeutsam, das die Mundbakterien diese Stoffe nicht abbauen können und somit keine Kariesgefahr
besteht. Viele zuckerfreie Bonbons enthalten Zuckeralkohole. In der EU sind 8 Zuckeralkohole als Lebensmittelzusatz zugelassen:
Sorbit
(E 420), auch "Eschenzucker"Mannit (E 421)
Isomalt (E 953)
Polyglycitolsirup (E 964)
Maltit (E 965)
Lactit (E 966)
Xylit (E 967), auch "Birkenzucker" genannt
Erythrit (E 968) Dieser Stoff wird weiter unten gesondert besprochen.
Xylit, der klassische Karieshemmer im Kaugummi
Seit langem wird Xylit, das natürlich in Birken vorkommt und deshalb auch "Birkenzucker" genannt wird, als zuckerfreie Alternative verwendet. Es hat 100% der Süßkraft von Zucker und 60% seiner Kalorien, kostet etwa vier mal so viel und eignet sich zum Backen und Kochen, weil es bis 200° hitzestabil ist. Allerdings wirkt es schon ab 20-30g abführend, weshalb es sich am ehesten für kleinvolumigen Zuckerersatz
eignet. Es wird von Mundbakterien nicht verstoffwechselt und ist zahnschonend. Studien der Universität Turku zeigten zudem eine bakterienhemmende und damit antikariogene Wirkung, wenn es z. B. als Zuckeraustauschstoff in Kaugummis eingesetzt wird.
Achtung: Xylit ist tödlich für Hunde!
Unser Fazit: Xylit ist ein idealer Zuckerersatz für kleine süße "Zwischenmahlzeiten" wie Bonbons oder Kaugummi.
Erythrit, der gefallene Star unter den Zuckeraustauschstoffen
Bis zum Jahr 2023 war der Zuckeralkohol Erythrit der "Star" unter den Zuckeraustauschstoffen, da er im Körper überhaupt nicht verstoffwechselt wird und somit überhaupt keine Kalorien hat. Was läge da näher, als alle Speisen und Getränke für Diabetiker komplett mit Erythrit zu süßen? Auch die Mundbakterien können Erythrit nicht verstoffwechseln und müssen hungern. Es gibt keine Insulinstimulation im Körper und es wirkt weniger abführend als der bekannte Zuckeraustauschstoff Xylit. Da Erythrit auch hitzestabil ist, eignet es sich auch zum Backen und Kochen. Allerdings kann die Backhefe Erythrit auch nicht verstoffwechseln, die Hefe geht nicht auf. Trotz des 4 x höheren Preises als Haushaltszucker findet Erythrit großen Absatz und wird für Menschen mit Gewichtsproblemen, Gefäßerkrankungen und Diabetes empfohlen.
Im Jahr 2023 wurden nun Langzeitstudien und tierexperimentelle Studien veröffentlicht, die auf ein erhöhtes Risiko für Gefäßverschlusskrankheiten
(Schlaganfall, Herzinfarkt, Thrombosen) bei Menschen hinweisen, die regelmäßig Erythrit zu sich nehmen. Dies ist besonders fatal, weil dieser Zuckeraustauschstoff ja gerade für Menschen geeignet zu sein schien, die ein höheres Risiko für genau diese Erkrankungen haben. Da Erythrit im Körper nicht abgebaut wird, reichert es sich in höheren Konzentrationen im Blut an, bis es unverändert über die Nieren ausgeschieden wird. Diese Erythritfracht
im Blut scheint dessen Gerinnungseigenschaften zu beeinflussen.
Die Original-Veröffentlichung können Sie unter folgendem Link nachlesen:
Die Original-Veröffentlichung können Sie unter folgendem Link nachlesen:
https://www.nature.com/articles/s41591-023-02223-9.epdf?sharing_token=P7SxTuQuWsi2Cxx2rg9a79RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MTnVt_Yzm2YDkmKtSZJOysYZlROr0ymfAdj9yPHH8bMS0DH8RbmAR5D3e48osgPeaBswHzT8dtDWzyQsRvQmrxd5HAOyFcczQI0K4og0NabKspksNKx55r97P3BoBGVicA_QZZaR1JKGC5OeANVyurNp-dYxkW-6lWvyOTNwXZ6Q%3D%3D&tracking_referrer=www.br.de
Fazit: Für Menschen mit einem erhöhten Risiko für Gefäßverschlusskrankheiten gilt ab sofort: Hände weg vom Erytrit, bis genauere Erkenntnisse vorliegen.
3) Süßstoffe => Zuckerfreie süß schmeckende Verbindungen
Zu dieser Gruppe gehören sehr unterschiedliche chemische Verbindungen, deren Süßkraft deutlich höher ist als beim Zucker. Aus diesem Grunde liefern sie einerseits kein Volumen (beim Backen) und haben keine bindende bzw. klebende Wirkung. Sie haben fast keine Kalorien und werden unterschiedlich verstoffwechselt. Der Geschmack ist nicht immer exakt zuckerähnlich, deshalb werden zum Teil Mischungen unterschiedlicher Süßstoffe verwendet, um bei hoher Süßkraft einen seltsamen Geschmack zu vermeiden. Über gesundheitliche Risiken beim Verzehr von Süßstoffen wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Die WHO empfiehlt, dass Süßstoffe nicht genutzt werden sollten, um eine Gewichtskontrolle zu erreichen oder das Risiko nichtübertragbarer Erkrankungen (Diabetes, Herzinfarkt etc.) zu reduzieren. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte ,bedingte Empfehlung' (conditional recommendation), also eine zurückhaltend ausgesprochene Empfehlung“. Harte Fakten, die auf gesundheitliche Gefahren bei "normalem Konsum" hinweisen, liegen nicht vor.
Zu dieser Gruppe gehören sehr unterschiedliche chemische Verbindungen, deren Süßkraft deutlich höher ist als beim Zucker. Aus diesem Grunde liefern sie einerseits kein Volumen (beim Backen) und haben keine bindende bzw. klebende Wirkung. Sie haben fast keine Kalorien und werden unterschiedlich verstoffwechselt. Der Geschmack ist nicht immer exakt zuckerähnlich, deshalb werden zum Teil Mischungen unterschiedlicher Süßstoffe verwendet, um bei hoher Süßkraft einen seltsamen Geschmack zu vermeiden. Über gesundheitliche Risiken beim Verzehr von Süßstoffen wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Die WHO empfiehlt, dass Süßstoffe nicht genutzt werden sollten, um eine Gewichtskontrolle zu erreichen oder das Risiko nichtübertragbarer Erkrankungen (Diabetes, Herzinfarkt etc.) zu reduzieren. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte ,bedingte Empfehlung' (conditional recommendation), also eine zurückhaltend ausgesprochene Empfehlung“. Harte Fakten, die auf gesundheitliche Gefahren bei "normalem Konsum" hinweisen, liegen nicht vor.
Eine negative Beeinflussung der Darmflora durch Süßstoffe wird für möglich gehalten (dies gilt allerdings auch für Zucker). Als Faustregel für unbedenklichen Konsum gilt: Wenn Sie die Menge an Süßstoff zu sich nehmen, die in Ihrer Süßkraft einer unbedenklichen Menge an Haushaltszucker entspricht, sind Sie auf der sicheren Seite.
Ein Glas Limonade mit Zucker oder mit Süßstoff am Tag ist also gleichermaßen unbedenklich. Es ist aber nicht sinnvoll oder ratsam, literweise sogenannte "Light"-Limonaden zu sich zu nehmen, bloß weil sie keine Kalorien enthalten.
In der EU sind 11 Süßstoffe zugelassen und tragen deshalb eine "E"-Kennnummer:
Acesulfam K (E 950):
Aspartam (E 951)
Cyclamat (E 952)
Saccharin (E 954)
Sucralose (E 955)
Thaumatin (E 957)
Neohesperidin DC (E 959)
Steviolglycoside (E 960)
Neotam (E 961)
Acesulfam-Aspartamsalz (E 962)
Advantam (E 969)
Aspartam (E 951)
Cyclamat (E 952)
Saccharin (E 954)
Sucralose (E 955)
Thaumatin (E 957)
Neohesperidin DC (E 959)
Steviolglycoside (E 960)
Neotam (E 961)
Acesulfam-Aspartamsalz (E 962)
Advantam (E 969)
Der Süßstoff Aspartam
(E 951) setzt beim Abbau im Körper die Aminosäure Phenylalanin frei. Menschen mit der Erbkrankheit "Phenylketonurie" dürfen diesen Süßstoff nicht zu sich nehmen. Aus diesem Grunde steht der Warnhinweis "Enthält eine Phenylalaninquelle!" auf Lebensmitteln, die mit Aspartam gesüßt sind.
Im Jahr 2023
hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Aspartam aufgrund tierexperimenteller Studien in die IARC-Gruppe 2b als "möglicherweise krebserregend" eingestuft. Mit großen Mengen Aspartam gefütterte Ratten zeigten ein höheres Auftreten von Tumorerkrankungen. Die WHO hält aber 40 mg/kg Körpergewicht Aspartam am Tag für unbedenklich. Diesen Wert würde ein 70 kg schwerer Mensch erst überschreiten, wenn er mehr als neun handelsübliche Dosen eines Aspartam-gesüßten Diätgetränkes täglich zu sich nimmt. Denken Sie an die oben genannte Faustregel für unbedenklichen Konsum von Zucker oder Süßungsmitteln.
"Hilfe, ich habe schon seit Jahren Aspartam zu mir genommen! Bekomme ich jetzt Krebs?"
Keine Panik. Zunächst git es die Aussage der WHO zu verstehen. Die IARC-Klassifikation hat 4 Stufen:
1 = krebserregend, 2a = wahrscheinlich krebserregend, 2b = möglicherweise krebserregend, 3 = nicht einstufbar oder
wahrscheinlich nicht
krebsauslösend
Die Klassifikation ermöglich die Einordnung von Verdachtsfällen und soll die wissenschaftliche Untersuchung von eventuellen Zusammenhängen fördern.
In die Klasse 1
(121 Substanzen bzw. Faktoren) gehören u. a. Tabakrauch, verarbeitetes Fleisch, alkoholische Getränke, Dieselabgase und Sonnenlicht. In der Klasse 2a
(93 Substanzen) finden sich u. a. Acrylamid (Bratenkruste), rotes Fleisch, heiße Getränke > 65°, Nachtarbeit und Glyphosat. In der Klasse 2b
(320 Substanzen) sind u. a. Mobilfunk, Titandioxid und nun auch Asparatam aufgeführt. Es wird unmöglich sein, allen Substanzen oder Einflussfaktoren aus diesen drei Gruppen komplett auszuweichen (Beispiel Straßenverkehr, Mobilfunk) . Harte medizinische Fakten existieren nur für Substanzen der Gruppe 1 und 2a.
Aspartam ist häufig in Kombination mit anderen Süßstoffen
(=> Geschmacksoptimierung) in zuckerfreien Bonbons enthalten. Zum Beispiel finden sich in den bekannten zuckerfreien Ricola-Bonbons (meine Lieblingsmarke) Aspartam, Sucralose und Acesulfam-K. Der Verzehr weniger Stück am Tag ist vollkommen unbedenklich.
In der beliebten Coca-Cola Zero ist die Süßstoffkombination Cyclamat, Acesulfam K und Aspartam. Ein Glas dieses Getränkes am Tag wird Ihnen genausowenig schaden wie der Konsum eines Glases "klassischer" Cola. Falsch wäre es jedoch, seinen Flüssigkeitsbedarf am Tag (2-3 Liter) komplett mit gesüßten zuckerfreien Getränken zu decken. Die WHO empfiehlt, haupsächlich Leitungs- oder Mineralwasserzu trinken.
Fazit: In vernünftigen Mengen ist Aspartam immer noch als unbedenklich anzusehen.
Stevia, die natürliche Alternative
In den letzten Jahren erfreuen sich Stevioglycoside (E960) einer wachsenden Beliebtheit. "Stevia" wird als natürlich beworben, allerdings im Rahmen der Herstellung aufwändig chemisch bearbeitet. Die Süßkraft entspricht der 300fachen von Haushaltszucker. Der Geschmack wird mit zunehmender Konzentration unangenehm. Wegen der hohen Süßkraft liefert Stevia kein Volumen. Da kein Stoffwechsel im Mund stattfindet, ist Stevia zahnschonend und aus zahnmedizinischer Sicht eine sinnvolle Alternative.
Stevia führt zu keiner Insulinstimulation und kann für Diabetiker sinnvoll sein, wirkt nicht abführend und ist für das Backen und Kochen geeignet, da es bis 200°C hitzestabil ist.
Stevia führt zu keiner Insulinstimulation und kann für Diabetiker sinnvoll sein, wirkt nicht abführend und ist für das Backen und Kochen geeignet, da es bis 200°C hitzestabil ist.
Fazit: Wer geschmacklich mit Stevia zufrieden ist, findet hier eine gute Alternative zu anderen Süßstoffen.
Problematisch: Süßstoff Sucralose (E 955) im Liquid von E-Zigaretten (Verdampfern)
E-Zigaretten (sog. Verdampfer) liegen bei jungen Menschen gerade voll im Trend. Fruchtig-süße Aromen sollen insbesondere Jugendliche zum Konsum verlocken. Dabei setzen die Hersteller auf den geschmacksverstärkenden Effekt des Süßstoffes Sucralose, der einen lang anhaltendem süßem Nachgeschmack liefert und so ein Genussverstärker ist.
Sucralose ist 600 x süßer als Zucker und zahnschonend. Problematisch ist, dass beim Erhitzen von Sucralose über 120° Celsius Schadstoffe entstehen können, die Verdampfer aber die Trägerstoffe des Liquids auf höhere Temperaturen bringen müssen, damit überhaupt Dampf entsteht (Siedepunkt Trägerstoff Glycerol (E 422) => 290°, Trägerstoff Propylenglycol (E 1520) => 188°). Durch die höheren Temperaturen können aus der Sucralose chlorierte organische Verbindungen entstehen, die möglicherweise einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Es liegen noch keine gesicherten Langzeitdaten zur Schädlichkeit von verdampften Süßstoffen vor.
Sucralose ist 600 x süßer als Zucker und zahnschonend. Problematisch ist, dass beim Erhitzen von Sucralose über 120° Celsius Schadstoffe entstehen können, die Verdampfer aber die Trägerstoffe des Liquids auf höhere Temperaturen bringen müssen, damit überhaupt Dampf entsteht (Siedepunkt Trägerstoff Glycerol (E 422) => 290°, Trägerstoff Propylenglycol (E 1520) => 188°). Durch die höheren Temperaturen können aus der Sucralose chlorierte organische Verbindungen entstehen, die möglicherweise einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Es liegen noch keine gesicherten Langzeitdaten zur Schädlichkeit von verdampften Süßstoffen vor.
Fazit: Mit Sucralose "gesüßte" Liquids sind möglicherweise gesundheitlich problematisch.
Untersuchungen zeigen zudem, dass E-Zigarretten weniger eine "Ausstiegsdroge" von ehemaligen Zigarettenrauchern, sondern eher eine "Einstiegsdroge" für Jugendliche sind, die später zu klassischen Zigaretten wechseln. Auch aus dieser Sicht sind E-Zigaretten kein unbedenkliches Genussmittel.

Interdentalbürsten sind studienbelegt das effektivste mechanische Hilfsmittel für die Reinigung der Zahnzwischenräume. Sie werden insbesondere bei vergrößerten Zahnzwischenräumen empfohlen. Diese finden sich insbesondere dann, wenn bereits ein Zahnfleischschwund eingetreten ist oder bei lückig stehenden Zähnen sowie um Implantate. Diese Bürsten verursachen auch bei jahrelangem Gebrauch keine Schäden und reduzieren nachweislich die Bakterienbeläge und den Entzündungsindex. Implantatträger profitieren von ihrem Einsatz besonders. Neuere Designformen ("Circum-Interdentalbürsten") mit unterschiedlich langen Borsten sollen einen besseren Kontakt mit den konvexen Zahnoberflächen ermöglichen. Ob diese Vorteile aber auch messbar bessere klinische Ergebnisse erbringen, ist noch nicht belegt. Unterschiedliche Arten von Zahnseide (ungewachst, gewachst, gewebt, montiert) sind inbesondere bei engeren Zahnzwischenräumen das Mittel der Wahl, also bei Menschen mit gesundem Zahnhalteapparat, aber auch bei engstehenden Zähnen (insbersondere bei "Kulissenstellung"). Sie unterscheiden sich nicht in Bezug auf ihre Effektivität. Ausschlaggebend sind hier die Geschicklichkeit und die Vorlieben des Anwenders. Zahnseide mit einer Einfädelhilfe ("Superfloss") kann in besonderen Situationen (Zahnersatz mit Stegen, Brückenkonstruktionen) sinnvoll sein, erfordert aber ein hohes Maß an Geschicklichkeit und einen höheren Zeiteinsatz als "gewöhnliche" Zahnseide. Interdental-Gummipicks bestehen aus einem Kern aus mittelhartem Kunststoff und einer strukturierten weichen Gummiauflage. Sie werden für engere bis mittlere Zwischenräume enpfohlen, wenn die Anwendung von Interdentalbürsten erschwert ist (der Draht kratzt) oder den Anwendern unangenehm ist. Die von der Spitze an zunehmende Dicke ermöglich die Reinigung unterschiedlich großer Zwischenräume. Da diese Hilfsmittel eine relativ neue Entwicklung sind, gibt es derzeit noch keine wissenschaftlichen Langzeituntersuchungen zu ihrer Effektivität. Lesen Sie hierzu auch unser Kapitel: " Zahnseide und Co. "

Ein Artikel aus den "Zahnärztlichen Mitteilungen" aus diesem Dezember. Wir zitieren ihn und glauben, das er eine gute Anregung für eigenen Überlegungen darstellt. Wir teilem den Standpunkt der Autoren Prof. Dr. Johan Wölber und Prof. Dr. Florian Bruns aus Dresden - an der Besteuerung hoch zuckerhaltiger Nahrungsmittel sollte sich etwas ändern.
Über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Zuckern, Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen haben wir in unserem Blog "Sinnvoller Umgang mit Süßungsmitteln" bereits berichtet. Darin ist auch die problematische Bewertung des Zuckeraustauschstoffes "Erythrit" nach neuen Studienergebnissen erwähnt worden. Sie finden ihn hier im Blogbereich, wenn Sie "show more" anklicken. Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln können grundsätzlich problematisch sein, weil unser Körper und seine natürliche Bakterienausstattung möglicherweise nicht in der Lage sind, sie zu tolerieren, schadlos auszuscheiden oder schadlos zu verstoffwechseln. Einige dieser Stoffe kommen auch natürlich in Pflanzen vor (z. B.: die Zuckeralkohole), werden aber in höheren Mengen der Nahrung zugesetzt. Andere (insbesondere die synthetischen Süßstoffe) kommen in der Natur (vermutlich) nicht vor. Schon bei der Zulassung von neuen Stoffen müssen diese also entsprechend untersucht werden. Allerdings werden diese Stoffe auch nach der Zulassung weiterhin erforscht. Eine dieser Studien hat sich nun mit einem "Newcomer" unter den Süßstoffen befasst: Es geht um den relativ neuen synthetischen Süßstoff Neotam. Der Süßstoff Neotam ist seit 2009 unter der Nummer E961 in der EU zugelassen. Seine Süßkraft beträgt das 7000-13.000fache einer vergleichbaren Menge Haushaltszucker (Saccharose). Er wird als Süßstoff und Geschmacksverstärker in Limonaden, Kaugummis und Bonbons verwendet. Da er keine Auswirkungen auf den Insulin- und Blutzuckerspiegel hat, ist er grundsätzlich für Diabetiker geeignet. Die neue Studie (s. u.) hat die Diskussion über Neotam neu angefacht. In dieser " in-vitro-Studie " (nicht an Lebewesen) wurde gezeigt, das Neotam Darmzellen direkt und indirekt über eine Veränderung der Bakterien schädigen kann. Allerdings ist dies keine Beobachtung am Menschen, sondern ein Vorgang quasi "im Reagenzglas", bei dem isolierte Zellen und zwei Bakterienstämme 24 Stunden lang dem Süßstoff Neotam ausgesetzt wurden. Diese lange Verweildauer ist im Menschen eher unrealistisch, sofern süßstoffhaltige Speisen nicht permanent konsumiert werden. Die Ergebnisse der Studie können ein Hinweis darauf sein, das dieser Süßstoff das Darmepithel direkt oder durch Veränderung von Darmbakterien schädigen könnte. Schäden an den Epithelzellen der Darmwand führen zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmwand, wodurch wiederum Stoffe aus dem Darm "ungefiltert" in den Körper eindringen und Entzündungen auslösen können.
Was ist in "Energy-Drinks" eigentlich drin?
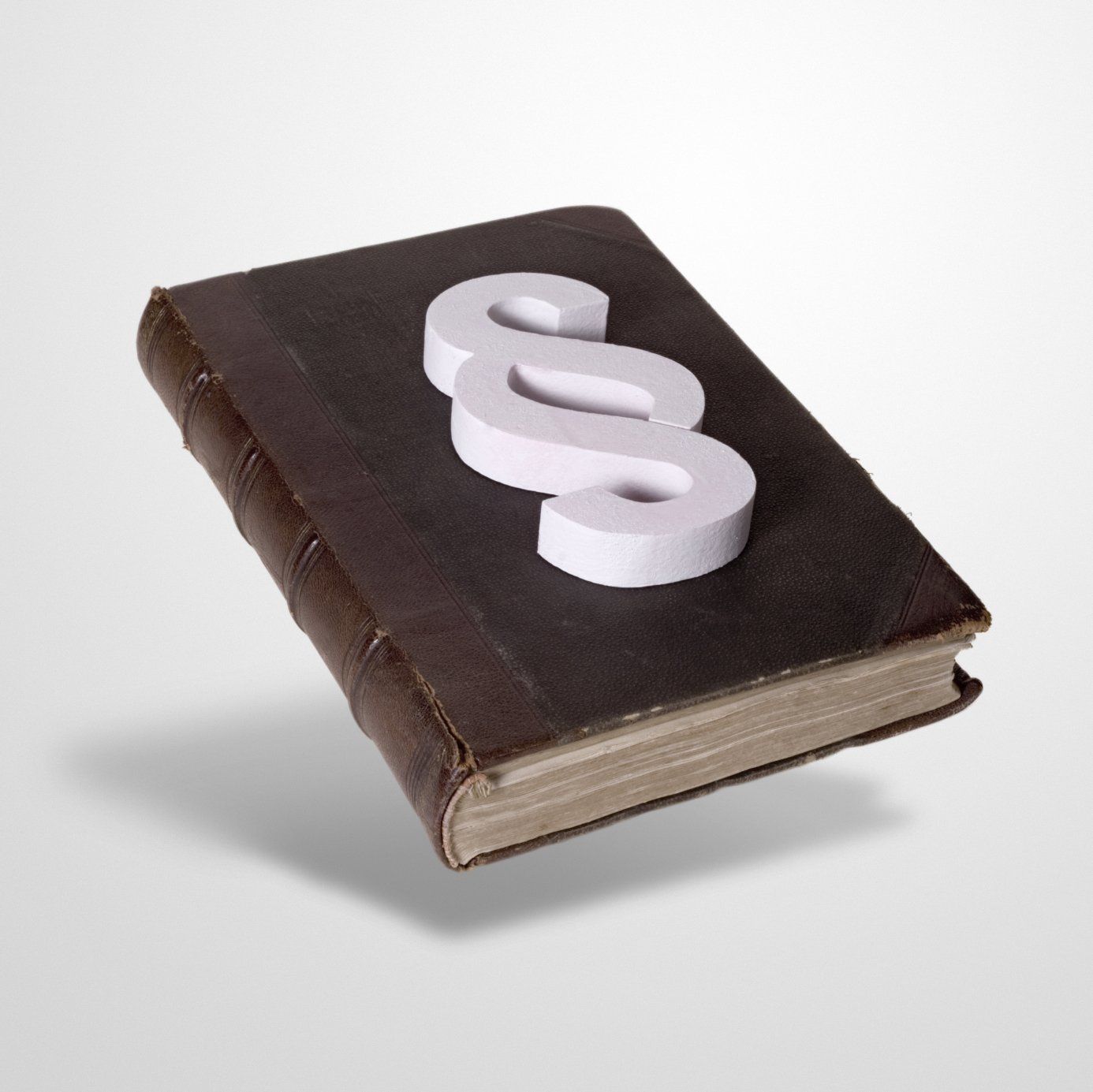
Verwendet unsere Praxis noch Amalgam? Nein. Wir haben in unserer Praxis die Verwendung von Amalgam schon vor über 25 Jahren komplett eingestellt. Bei Kindern und Jugendlichen haben wir es nie verwendet. Im Jahr 2018 hat die EU die Verwendung des Materials bei Schwangeren und Kindern unter 15 Jahren verboten. Nur für diesen kleineren Personenkreis übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die höheren Kosten einer Kompositefüllung. Wir bieten in unserer Praxis sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtige Alternativen zum Amalgam an. Alle Patienten werden vor der Behandlung über eventuell anfallende Kosten bei der Versorgung mit höherwertigen Materialien informiert. Welche Konsequenzen ein EU-Amalgamverbot für die zukünftige Kostenübernahme von Kompositefüllungen (" Kunststofffüllungen ") durch die Krankenkassen haben wird, können wir derzeit noch nicht abschätzen. Für das Jahr 2024 ändert sich erst einmal nichts.
Vor nicht allzu langer Zeit waren Karies (" Zahnfäule ") und lockere Zähne durch Parodontitis (" Zahnfleischschwund ") die Hauptursachen für den Verlust von Zahnsubstanz und Zähnen. Erfreulicherweise hat sich das geändert: Durch die verbesserte Mundhygiene bleiben mehr und mehr Menschen weitgehend kariesfrei und das Zahnfleisch und der Zahnhalteapparat werden gesund erhalten. In den letzten zwei Jahrzehnten rücken andere Schadensformen an den Zähnen mehr und mehr in den Vordergrund. Es sind Substanzverluste an den Oberflächen der Zähne, die durch mechanische ("Zähneknirschen", beschleunigter Zahnabrieb) oder chemische (Säureschäden) Einflüsse zu massiven Formveränderungen der Zähne, zum Absinken der Bisshöhe oder zum Freiliegen von empfindlichen Zahnarealen führen. Nach dem kompletten Verlust des schützenden Schmelzmantels liegt dann das Zahninnere, das Dentin frei, was zudem zu stark schmerzempfindlichen Zähnen führen kann. Natürlicher Oberflächenverlust (= Physiologische Demastikation) Jedes Gebiss unterliegt normalerweise einem kontinuierlichen Abrieb durch die Nahrungsbestandteile und die jeweilige Gegenbezahnung bzw. durch den Einfluss von natürlichen Säuren aus der Nahrung. So haben 20jährige in nur drei Prozent der Fälle einen stark sichtbaren Abriebsverlust (Abrieb bis in das mittlere Dentindrittel), wohingegen 70jährige diesen zu 17 Prozent aufweisen. Über 80% der 70jährigen haben zwar gealterte, aber grundsätzlich intakte Zahnoberflächen. Im Normalfall müssten unsere Zähne vom Abrieb her für ein ganzes Leben halten, weil wir in 10 Jahren nur etwa 0,3 mm an Zahnschmelz verlieren. Da der Schmelzmantel der Zähne im Bereich der Kaufläche ca. 1,5 mm dick ist, sollten wir die ersten 50 Jahre der Zahnnutzung ohne Freilegung von Dentin schaffen. Dies gilt umso mehr, als wir in unseren "modernen Zeiten" die Zähne nicht mehr als Werkzeug nutzen oder auf Steinen gemahlenes Mehl zu uns nehmen müssen. Das Mehl mit dem Sandzusatz wirkte in früheren Zeiten zu Brot gebacken wie Schmirgelpapier. Gebisse von Menschen, die vor mehr als 250 Jahren lebten, zeigen einen deutlich höheren Substanzverlust als heutzutage üblich. Es ist grundsätzlich sehr wichtig, krankhafte Substanzverluste schon in einem frühen Stadium zu entdecken, um massive Schäden und hohe Folgekosten für aufwendige Zahnrekonstruktionen zu vermeiden. Insbesondere kann sich der Abrieb verstärken, wenn das Dentin ("Zahnbein") an der Zahnoberfläche durch den vollständigen Verlust des Zahnschmelzes frei zu liegen beginnt, weil Dentin fünf mal weicher als Zahnschmelz ist. Was sind die Ursachen für einen beschleunigten Verlust von oberflächlicher Zahnsubstanz, der nicht durch Karies verursacht sind ? Wir unterscheiden hier zwei Schadensmechanismen, die im schlimmsten Fall kombiniert auftreten können:

Moderne Zahnerhaltung funktioniert . Immer mehr Menschen behalten immer mehr eigene Zähne bis in hohe Lebensalter. Dieser Erfolg wird für Deutschland durch repräsentative Studien bestätigt, zum Beispiel durch die fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V) von 2016. Mehr eigene Zähne im Mund - das ermöglicht Zahnärzten, in weit höherem Maße als früher Zahnersatz anzufertigen, der fest im Mund verankert ist, also Kronen und Brücken anzufertigen, statt wie früher einen herausnehmbaren Zahnersatz herzustellen. Die Lebensqualität der so versorgten Menschen ist höher, der Kaukomfort und die Kauleistung steigen. Dieser Trend wird durch den Einsatz von Zahnimplantaten noch verstärkt, weil diese strategische eingesetzten künstlichen Zahnwurzeln die Möglichkeiten der fest sitzenden Verankerung für Zahnersatz nochmals erweitern. Die Gruppe der Menschen, die zahnlos und mit einer Totalprothese versorgt sind, wird kleiner. Diese erfreuliche Entwicklung hat allerdings auch eine Schattenseite. Wo früher Totalprothesen mit einer "Kukident"-Reinigungstablette über Nacht im Wasserglas auf dem Nachttisch gereinigt werden konnten, müssen nun auch im hohen Alter die eigenen Zähne im Mund gepflegt werden. Mit steigendem Lebensalter treffen zwei Entwicklungen aufeinander: Zum einen steigt mit höherem Alter die Gefahr für Karies gegenüber dem mittleren Alter an. Freiliegende Zahnhälse, vergrößerte Zahnzwischenräume und abgenutzte Schmelzareale sowie eine geringere Speichelproduktion vergrößern die Anfälligkeit für Karies. Einschränkungen bei der Mundhygiene (Beweglichkeit von Schulter, Arm und Fingern, Sehschärfe etc.) begünstigen die Entstehung schädlicher Bakterienbeläge auf den Zahnoberflächen. In besonderem Maße sind Menschen gefährdet, die pflegebedürftig sind und noch eigene Zähne haben. Hier vergrößert sich der allgemeine Pflegebedarf durch die technisch herausfordernde Pflege der Zähne noch einmal deutlich. Und gerade in diesem Bereich gibt es zur Zeit noch die größten Defizite sowie einen hohen Informationsbedarf. Für Angehörige und Pflegende gibt es seit eine sehr informative Informations- und Lernplattform im Internet: https://mund-pflege.net/ Auf dieser vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützten Plattform werden eine Vielzahl von Informationen und praktische Tipps gegeben. Die Kapitel sind durchgehend bebildert, frei von Werbung und gut verständlich. Ein Blick auf diese Seite lohnt sich für jeden!

